DIE GUARANÍ

Der Name Guaraní ist die Bezeichnung einer indigenen Bevölkerungsgruppe in Südamerika, etwa 2 Prozent der Bevölkerung Paraguays sind Guaraní, die immer in Gemeinschaft eine Fläche Land bewohnen und bewirtschaften. „Wir Guaraní haben immer im und vom Wald gelebt. Aber Großgrundbesitzer mit ihren über 1 000 Hektar großen Sojaplantagen haben uns den Wald weggenommen.“
Mit lustigen Kapriolen flattert der bunte Schmetterling über das Sojafeld. Mehrere Hektar sattes Grün, ausgesät in Reih und Glied. In der Ferne tuckert ein Traktor und versprüht Pestizide, um Pilze und Schädlinge fernzuhalten. Der Schmetterling zieht weiter, kreuzt den Feldweg und lässt sich dann auf dem Erbsenacker von Don Anselmo nieder. Die Augen des hageren, alten Guaraní-Häuptlings sind müde, doch der Schmetterling entgeht ihm nicht. Der Alte hält inne, seine Mundwinkel verziehen sich zu einem Lächeln. Noch sind sie nicht alle verschwunden, die Schmetterlinge. Die bunten Falter sind ein gutes Omen für die Guaraní, der Legende zufolge sind sie der Ursprung des Regenbogens.

- © Kopp/MISEREOR
„Früher gab es noch viel mehr Schmetterlinge hier, Wildkatzen und Rehe“, erinnert sich Anselmo Miranda. Früher war vieles anders in der fruchtbaren Ebene Ostparaguays. „Wir hatten 150 Quadratkilometer und konnten umherziehen, wie wir wollten.“ Damals hatten sie noch genügend Tiere zum Jagen, genügend Früchte zum Essen, genügend saubere Flüsse zum Fischen. Mehr brauchten die Guaraní nicht. Seit Jahrhunderten reichten die Schätze der Natur diesem stolzen Nomadenvolk, das einst große Teile Südamerikas besiedelte. Dann kamen die Siedler, Zuwanderer aus Brasilien, Asien und Europa, und begannen, Weiden und Äcker einzuzäunen und Bäume zu fällen. Heute sind 80 Prozent der Wälder Ostparaguays verschwunden, unzählige Flüsse versiegt, und auf dem fruchtbaren Boden gedeiht Soja, soweit das Auge reicht. Auch wer Don Anselmo in Jaguary besuchen will, muss durch die grüne Wüste. Insgesamt 2,8 Millionen Hektar, etwa drei Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche, sind mit der proteinhaltigen Sojabohne bepflanzt, mit der Vieh in Europa gemästet wird. Ein Milliardengeschäft, das in den Händen multinationaler Konzerne und ausländischer Großbauern ist.
Don Anselmo mag die fremden Siedler nicht besonders: Sein Stamm zog sich zurück, immer tiefer in die Wälder. Jaguary nannten sie ihr letztes Rückzugsgebiet, in dem heute rund 120 Familien leben. Für die Sojabauern ist es „Campo Nueve“, Feld Nummer neun. Sie fällten immer mehr Bäume für immer neue Felder. Don Anselmo und seine Familie fanden immer weniger zu essen. „Aus der Not heraus begannen wir, wie die Bauern zu wirtschaften, wir legten Feuer, um die Felder zu roden, pflanzten Mais, Bohnen und Maniok an“, erzählt Don Anselmo. Doch während die benachbarten Großgrundbesitzer mit Hilfe von Dünger, Schädlingsbekämpfungsmitteln und großen Maschinen dicke Ernten einfuhren, gaben die Äcker der Guaraní nur wenig her. Und manchmal, wenn der Wind die Pestizide zu ihnen blies, verendeten die Hühner, vertrockneten die Felder und jammerten die Kinder über Bauch- und Kopfschmerzen.

- © Kopp/MISEREOR
„Sie wurden immer reicher und wir immer ärmer“, beobachtete Don Anselmo. Die indigene Bevölkerung sei faul und wisse eben nicht, wie man Land richtig bewirtschafte, behaupten die Großgrundbesitzer. Man müsse ihnen eben richtig beibringen, wie man intensive Landwirtschaft betreibe. Nichts liegt der Guaraní-Mentalität ferner, in der Mensch und Natur eng miteinander verwoben sind. Don Anselmo ahnte, was kommen würde: Eines Tages standen Großgrundbesitzer vor seiner Hütte, in Begleitung der Polizei. „Sie wedelten mit einem angeblichen Besitztitel und sagten, wir müssten von hier fort“, erinnert sich der 60jährige. „Damals herrschte Diktatur, und die Großbauern hatten die Regierung auf ihrer Seite“, sagt er resigniert. Trotzdem versuchte Don Anselmo, vor Gericht einen Titel auf das Stammesland zu erstreiten – 700 Hektar. 1982 begann das Verfahren, vorangetrieben von der von MISEREOR unterstützten Indigenenpastoral der Diözese Coronel Oviedo. Bis heute hat sich der Oberste Gerichtshof dazu nicht geäußert. Gerade einmal die Hälfte der paraguayischen Indigenengemeinden besitzt einen Landtitel. Aber selbst das verhindert nicht die schleichende Enteignung – so wie in Jaguary. Dort haben die Familien nach einer Missernte vor sieben Jahren damit beginnen müssen, einen Teil ihres Landes an die Sojabauern zu verpachten, 120 Hektar. Das bringt 1,8 Millionen Guaranís im Jahr (320 Euro) pro Familie. Paraguays Währung heißt ironischerweise genauso wie das indianische Urvolk, das nie Geld brauchte, weil es sich selbst versorgte. Jetzt reichen ihnen nicht einmal mehr die Einnahmen von der Feldvermietung.
Traurig beobachtet Don Anselmo, wie immer mehr Jugendliche als billige Tagelöhner arbeiten oder in der Hoffnung auf schnellen Reichtum in die Städte abwandern. Manch einer hat zuhause jetzt einen CD-Player, sogar Betten und einen Dieselgenerator. Doch die Matratzen sind feucht, weil es durch das Wellblechdach regnet, und Geld für Diesel ist eigentlich nie da. Zivilisationsruinen – während die Lebens- und Ernährungsgrundlage der Guaraní immer mehr schwindet.
Text: Sandra Weiss für MISEREOR (leicht gekürzt)




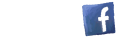
















Kommentieren
* E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.
Dein Kommentar ist nach Bestätigung durch das Redaktionsteam sichtbar.